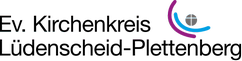Artikel Archiv
Pest, Cholera und Corona
12.1.2023

LÜDENSCHEID + Dr. Werner Max Ruschke (Jahrgang 1948), der in Soest lebt, stammt aus Lüdenscheid und ist der Stadt durch seine Teilnahme an den jährlich stattfindenden Klassentreffen bis heute verbunden geblieben. Er besuchte das Zeppelin-Gymnasium, war auch mal dessen Schulsprecher und durfte die Abiturrede seines Jahrgangs halten. Nach dem Abitur (1967), dem Studium der Evangelischen Theologie und der Promotion war er unter anderem Gemeindepfarrer in Hagen, für die Öffentlichkeitsarbeit der von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel verantwortlich und 13 Jahre – bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2014 – Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Perthes-Werks in Münster. In dieser Eigenschaft war er häufig in Lüdenscheid – im Amalie-Sieveking-Haus, im Hospiz, im Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum, bei der Wohnungslosenhilfe oder den damit verbundenen Sozialwerkstätten.
Wie er berichtet, wurde er in seiner Heimatstadt von seinem 10. Lebensjahr an durch den CVJM Lüdenscheid-West geprägt, in dem er einige Jahre selbst eine Jungschargruppe leitete und auch als Bläser aktiv war. Seine Prägung habe er dem damaligen Jugendwart Herbert Dawin und Pfarrer Paul Deitenbeck zu verdanken. Als Ruheständler nimmt Ruschke immer noch zahlreiche Aufgaben wahr: Er hat viele kirchliche Sendungen (vor allem im WDR und DLF) gestaltet, ist durch vielfältige geistliche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften sowie durch Veröffentlichungen zu Literatur und Theologie – unter anderem zur diakonischen Theologie – bekannt geworden. Seine Liebe zur Literatur wurde durch den Unterricht seines Deutsch- und Klassenlehrers Helmut Noll am „Zepp“ geweckt.
Da Epidemien bisher in theologischen Werken kaum thematisiert wurden, hat Werner M. Ruschke jetzt ein rund 150 Seiten starkes Buch unter der Überschrift „Pest, Cholera und Corona in der Belletristik - Wege der Verantwortung“ herausgebracht. In dem Band, der im Steinmann-Verlag (Neuenkirchen bei Soltau) erschienen ist und zum Preis von 16,80 Euro über den Buchhandel bezogen werden kann, ist er der Frage „In welcher Weise verarbeiten Schriftsteller unterschiedlicher Zeiten und Generationen die Grenzerfahrungen von Seuchen und Epidemien?“ nachgegangen.
Anhand von 20 bedeutenden Werken der Belleristik – angefangen bei Giovanni Boccaccios „Das Dekameron“ (1351) bis zu den im Jahre 2021 erschienenen Veröffentlichungen von Thea Dorn („Trost. Briefe an Max“) und „Poesie und Pandemie“ von Safiye Can, beschreibt er, wie Epidemien seit jeher das Leben Einzelner bedrohten und das gesellschaftliche Miteinander verunsicherten. Zu den weiteren Romanen und Gedichtbänden, mit denen er sich intensiv beschäftigt hat, gehören unter anderem Daniel Defoes „Die Pest in London“ (1722), Mary Shelleys „Der letzte Mensch“ (1826), Edgar Allan Poes „Die Maske des roten Todes“ (1842), Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ (1912), Albert Camus‘ „Die Pest“ (1947) und Friedrich Dürrenmatts „Die Virusepidemie in Südafrika“ (1994).
Manche Reaktionen auf die Pandemien der Vergangenheit sind den heutigen Menschen aus der weltweiten Corona-Gegenwart vertraut – so zum Beispiel die Tatsache, dass Verschwörungstheorien die Schuld zugesprochen wurde und nicht natürlichen Ursachen wie dem langen Beisammensein und den vielfältigen Berührungen zahlreicher Menschen. Den „Corona“-Partys vergleichbare zügellose Feste, durch die Menschen über die Schrecken ihrer Zeit hinwegkommen wollten, führten zum Beispiel dazu, dass die Pest in Mailand (in Alessandro Manzonis Werk „Die Verlobten“) 140.000 Menschen hinwegraffte. Auch in der Vergangenheit gab es – wie in der Gegenwart – bereits Kritik an staatlichen Anordnungen. Für einige Autoren – zum Beispiel für Albert Camus – ist Pest gleichbedeutend mit Faschismus, Stalinismus oder Französischer Revolution. Immer wieder geht es in den vorgestellten Werken um die Frage, von welchen sittlichen und ethischen Impulsen sich die handelnden Hauptpersonen leiten ließen, um „Sittlichkeit an guten wie an schlechten Tagen“ zu üben.
Einige Autoren stellen das solidarische Handeln Einzelner als vorbildlich heraus. So zeigt zum Beispiel der Brite John Ironmonger (in „Der Wal und das Ende der Welt“, 2015) auf, wie man durch solidarisches Verhalten den möglichen Folgen einer Epidemie erfolgreich begegnen kann. Fast alle Autoren verstehen eine Epidemie auch als religiöse Herausforderung. Während es bei Defoe und Manzoni eine grundsätzliche Zustimmung zum Christentum gibt, beklagen andere Epidemien als Plagen Gottes. Mit Unverständnis begegnet man vor allem der Tatsache, dass unzählige Unschuldige von den Strafen getroffen werden. Man suchte nicht nach von Menschen verursachte Gründen für Seuchen und Epidemien, sondern betrachtete sie als Gottesstrafen: Laut Ruschke überzeugen alle theologischen und philosophischen Versuche nicht, das Böse sowie das Leiden – zumal Unschuldiger – als sinnvoll und gerechtfertigt zu erklären. Es sei auch unmöglich, schlüssig zu erklären, warum es das Böse in Gestalt todbringender Epidemien gibt und wie diese mit der Güte Gottes in Einklang zu bringen sind. Christen können ihre Klagen vor Gott bringen und ihn gleichzeitig um Hilfe bitten, anderen Menschen den Trost des Glaubens bieten, ihre Not lindern und die Macht des Bösen im Wissen um das von Gott gewollte Gute eindämmen. Laut Ruschke geben Epidemien Christen Anlass, aus biblischen Traditionen Lehren für ihr Leben als Einzelne und für ihre Gemeinden zu ziehen. Er bezeichnet Epidemien auch als „Härtetests für die Tragfähigkeit ethischer Überzeugungen“. ©ih